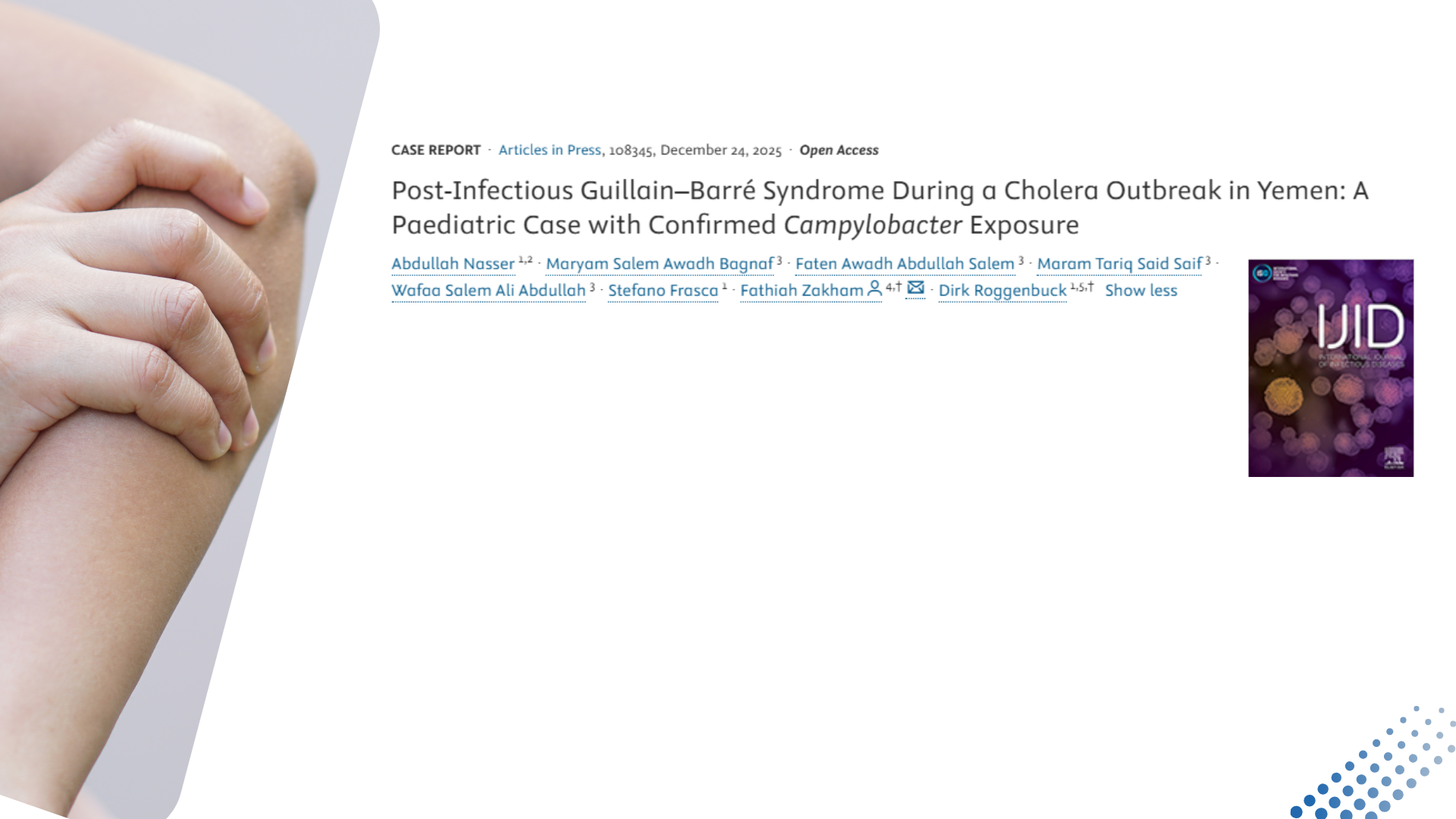Von Biomarkern bis KI: Highlights des 17. Dresdner Symposiums über Autoantikörper 2025

Das Dresdner Symposium über Autoantikörper 2025 bestätigte erneut seine Bedeutung als wegweisende Veranstaltung zur Autoimmunität.
Internationale Expertinnen und Experten diskutierten die neuesten Fortschritte.
Das Symposium bot Einblicke in Autoimmunerkrankungen, neue Biomarker und technologische Innovationen.
Diese Erkenntnisse prägen die Zukunft von Diagnostik und Patientenversorgung.
Medipan & GA Generic Assays trugen mit einer Vortragsreihe zum Erfolg bei.
Zusätzlich präsentierten wir unsere Lösungen im Bereich Autoantikörper am Messestand.
Autoantikörper gewinnen sowohl in der Diagnostik als auch in der Forschung zunehmend an Bedeutung. Diese Biomarker ermöglichen die Früherkennung von Erkrankungen und vertiefen zugleich unser Verständnis der Immunregulation.
Damit werden sie zu einem zentralen Element der personalisierten Medizin.
Die folgenden Highlights zeigen die wichtigsten wissenschaftlichen Erkenntnisse.
Wir empfanden sie als besonders inspirierend und für Medipan & GA Generic Assays hochrelevant.
Fortschritte in der Rheumatoiden Arthritis (RA)-Forschung
Das Symposium eröffnete mit einem tiefgehenden Blick auf die rheumatoide Arthritis (RA)1 und zeigte den dynamischen Fortschritt im Verständnis und Management dieser komplexen Erkrankung:
- Lieve van Hoovels (Belgien) stellte die traditionelle RA-Klassifikation infrage, indem sie Anpassungen an den Scores für Rheumafaktor (RF) und Antikörper gegen cyclische citrullinierte Proteine/Peptide (ACPA) vorschlug, um Fehleinstufungen zu verringern.
- Ulrike Steffen (Deutschland) identifizierte die IgA-ACPA-Subklasse als wichtigen prognostischen Marker (wenn auch von begrenztem diagnostischem Wert), der mit einem erhöhten Risiko für Krankheitsprogression bei Risikopersonen assoziiert ist. Zudem erwies sich IgA-ACPA als Stratifizierungsmarker für präventive Therapien.
- Ricard Holmdahl (Schweden) brachte eine neue Perspektive ein, wonach sowohl B-Zellen als auch Autoantikörper unter bestimmten Bedingungen eine protektive Rolle bei RA spielen können.
- Michael Mahler (USA) gab einen Überblick über den aktuellen Stand der RA-Prädiktion und Präventionsstrategien und stellte etablierte sowie neue Biomarker vor.
Diese Sitzung verdeutlichte, wie ein vertieftes Verständnis von RA-Biomarkern die Früherkennung und Patientenergebnisse transformieren kann.
Komplexität des Antiphospholipid-Syndroms (APS) und systemischer Lupus erythematodes (SLE)
Ein weiterer Schwerpunkt lag auf den Herausforderungen des APS und SLE, Erkrankungen, bei denen eine präzise serologische Diagnostik entscheidend ist:
- Mar Petit (Spanien) präsentierte aktuelle Fortschritte in der APS-Diagnostik, die Brücken zwischen Autoantikörperforschung und klinischer Praxis schlagen.
- Maria Orietta Borghi (Italien) stellte die neuen 2023 ACR/EULAR-APS-Klassifikationskriterien2 vor, die einen wichtigen Schritt zur Standardisierung der Diagnose darstellen. Für die klinische Praxis bleibt jedoch eine umfassende Bewertung von Symptomen, Anamnese und Laborbefunden unverzichtbar.
- Lieve van Hoovels (Belgien) griff den Likelihood-Ratio-Ansatz erneut auf, der ein vielversprechendes Instrument zur Verbesserung der diagnostischen Zuverlässigkeit bei APS darstellt.
Die Beiträge verdeutlichten, wie sich neue Strategien entwickeln, die diagnostische Strenge mit klinischer Realität verbinden.
Neue Autoantigene und aufkommende Technologien
Die von Medipan & GA Generic Assays gesponserte Sitzung „Neue Autoantigene und aufkommende Technologien zur Autoantikörperdetektion“ gehörte zu den innovativsten Programmpunkten des Symposiums:

- Dirk Roggenbuck (Deutschland) stellte Glykoprotein 2 (GP2) als neuen fäkalen Marker vor, der eine Verbindung zwischen Dysbiose des Darmmikrobioms und systemischer Entzündung herstellt3.
- Jonas Schmidt (Deutschland) verglich die KI-basierte ANA-Musterinterpretation des akiron® NEO mit Expertenbewertungen und zeigte, wie Künstliche Intelligenz den diagnostischen Workflow revolutionieren kann. Die Ergebnisse waren mit Expertenleistungen vergleichbar.
- Rico Hiemann (Deutschland) vertiefte die Anwendungen von KI im akiron® NEO, indem er Algorithmen zur gewebebasierten Immunfluoreszenz vorstellte, die eine Standardisierung zwischen Laboren ermöglichen.
- Dimitrios Bogdanos (Griechenland) untersuchte die potenzielle Rolle von Helicobacter pylori als Auslöser für ANA und eröffnete damit spannende Fragen zur Rolle von Mikroben bei systemischer Autoimmunität.
Das Sateliten Symposium zeigte, wie Technologien der nächsten Generation die Autoantikörperdiagnostik präziser und effizienter machen.
Die Zukunft der Autoimmun-Diagnostik
Themen der Sitzung beleuchteten die Zukunft der Autoimmun-Diagnostik:
- María Luisa Mearin (Niederlande) thematisierte die zunehmende weltweite Belastung durch Autoimmunerkrankungen und erörterte die Risiken von Über- versus Untertestung. Beispielhaft nannte sie die Einführung von Screenings für Typ-1-Diabetes und Zöliakie in der italienischen Pädiatrie4.
- Jan Damoiseaux (Niederlande) analysierte die Folgen einer ungezielten diagnostischen Ausweitung und plädierte für maßgeschneiderte Ansätze gegen Kosten, Zeitaufwand und Ängste.
- Maria Infantino (Italien) sprach über die Nachhaltigkeit und Angemessenheit von aPL-Tests und rief Ärzt*innen dazu auf, Genauigkeit und Ressourcenmanagement auszubalancieren.
- Nicola Bizzaro (Italien) stellte die neuen italienischen Leitlinien für die immunologische Diagnose autoimmuner Lebererkrankungen5 vor. Sie bauen auf den EASL-Empfehlungen auf und betonen die zentrale Rolle von Autoantikörpern (ANA, SMA, LKM, SLA, AMA) bei AIH und PBC. Zudem schlug er aktualisierte Cut-off-Werte sowie die konsequente Nutzung von HEp-2-Zellen vor, um Sensitivität und Spezifität zu verbessern.
Diese Beiträge schlossen das Symposium mit einer klaren Botschaft: Nachhaltige, patientenzentrierte Teststrategien werden entscheidend sein, da Autoimmunerkrankungen weltweit weiter zunehmen.
Conclusion

Das Dresdner Symposium über Autoantikörper 2025 hat gezeigt, wie kollaborative Wissenschaft bedeutende Fortschritte vorantreibt. Von innovativen KI-Technologien bis zu verfeinerten Krankheitsklassifikationen verdeutlichte die Veranstaltung die Notwendigkeit, Forschung, Diagnostik und klinische Praxis enger zu verknüpfen.
Auch 2025 bestätigte sich Dresden als Epizentrum der Autoantikörperforschung, wo Ideen in bessere Patientenergebnisse überführt werden.
Wir freuen uns bereits jetzt auf das nächste spannende Treffen in Dresden im Jahr 2027!
References
- Aletaha et al., (2010) Rheumatoid arthritis classification criteria: an American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative ↩︎
- Barbhaiya, et al. (2024). The 2023 ACR/EULAR Antiphospholipid Syndrome Classification Criteria ↩︎
- Aletaha et al., (2010) Rheumatoid arthritis classification criteria: an American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative ↩︎
- Catassi, et al., (2024)Pediatric screening for type 1 diabetes and celiac disease: the future is today in Italy ↩︎
- Sorrentino, et al. (2024), Italian Society of Clinical Pathology and Laboratory Medicine guidelines on the use of autoantibody tests in the diagnosis of autoimmune liver diseases ↩︎